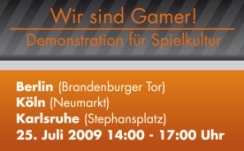Publikationen
Jugendmedienschutz in Deutschland - wirkungsvoll und vorbildlich
Beitrag von Jörg Tauss in "tv diskurs“, 40, 2/2007. S.46-47
Nach dem schrecklichen Amoklauf eines Jugendlichen in Emsdetten ist in unserem Land wieder einmal eine kontroverse politische Debatte um Computerspiele entbrannt. Wieder einmal wird landauf und landab, und leider auch quer durch alle Parteien, ein Verbot von so genannten „Killerspielen“ gefordert und dabei eine Terminologie bemüht, die juristisch kaum zu fassen ist. Und wieder einmal hat man Gewaltbeinhaltende Computerspiele pauschal als einzige Ursache für eine solche Tat ausgemacht.
Dieser Zusammenhang ist falsch man macht es sich viel zu einfach. Denn es geht in dieser Frage um mehr: um das Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen, um die Schule, um die (fehlende) Anerkennung und Förderung von Kindern und Jugendlichen, auch um ihre Perspektivlosigkeit, um die Prävention und Bekämpfung von Jugendgewalt, um die Hilflosigkeit von Eltern und Pädagogen, um Fragen von Medienkompetenz und Jugendmedienschutz sowie den Zusammenhang zwischen schlechten Schulleistungen und Medienkonsum.
Obgleich alle seriösen wissenschaftlichen Studien zeigen, dass es keinen direkten ursächlichen Zusammenhang von Computerspielen und realen Brutalitäten gibt, ignoriert gegenwärtig beispielsweise das Land Bayern diese Tatsachen, und versucht über eine Initiative im Bundesrat ein totales Verbot von so genannten „Killerspielen“ zu erreichen. Ich halte diese Initiative aus München für einen unseriösen und populistischen Schnellschuss, der wieder einmal auf Kosten einer sicherlich notwendigen, aber eben sachlich geführten Diskussion zu diesem komplexen Themenbereich geht
und daher ein Paradebeispiel für symbolische Politik und bayerischen Pseudo-Aktionismus darstellt. Unseriös und symbolisch ist der bayerische Ansatz auch deshalb, weil damit so getan wird, als ob es in Deutschland bisher keinerlei gesetzliche Regelungen zum Schutz von Jugendlichen vor gewaltverherrlichenden Medien gebe.
Das Gegenteil ist der Fall, denn Deutschland besitzt bereits heute eines der vorbildlichsten, weitreichendsten, konsequentesten und wirkungsvollsten Jugendmedienschutzgesetze weltweit. Das dem Jugendmedienschutzgesetz zu Grunde liegende Konzept der Dreistufigkeit hat sich bewährt. Unsere Jugendmedienschutzgesetze finden daher zu Recht internationale Anerkennung und daher auch innerhalb der europäischen Union zu Recht Nachahmung und Etablierung.
Mit dem Inkrafttreten des Jugendschutzgesetzes und des Jugendmedienschutz- Staatsvertrages im April 2003 wurden bestehende gesetzliche Regelungen verschärft und angesichts der Entwicklungen im Bereich der Neuen Medien angepasst oder teilweise grundlegend neu geregelt. Insbesondere Computerspiele wurden mit der Novellierung den gleichen gesetzlichen Regelungen wie Kinofilme und Videos unterworfen und müssen wie diese auch, in einer ersten Stufe mit einer Altersfreigabekennzeichnung versehen werden. Kindern und Jugendlichen dürfen nur die Angebote zugänglich gemacht werden, die für ihre Altersstufe freigegeben sind. Die Klassifizierung erfolgt in einem System der staatlich überwachten Selbstkontrolle. Das Prüfverfahren zur Altersfreigabe bei Computerspielen wird durch die Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle (USK) und unter Mitwirkung der Obersten Landesjugendbehörden durchgeführt.
Diese erste Stufe reicht aber bei weitem nicht aus um einen wirksamen Schutz von Kindern und Jugendlichen zu erreichen. In einer zweiten Stufe können und werden jugendgefährdende Träger- und Telemedien durch die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien (BPjM) indiziert und dürfen Kindern oder Jugendlichen damit weder verkauft, überlassen oder anderweitig zugänglich gemacht werden. Im Bereich der Computerspiele erhalten durchschnittlich fünf bis sechs Prozent der von der USK begutachteten Spiele keine Jugendfreigabe. Wenn die USK ein Siel als schwer jugendgefährdend einstuft, wird jenes nicht gekennzeichnet. Somit besteht die Möglichkeit einer Indizierung durch die BPjM. Eine Indizierung bedeutet nicht das Verbot des Mediums, erschwert aber damit selbst den Erwerb der Medien für Erwachsene.
Ein Verbot von Computerspielen ist bereits jetzt durch die dritte Stufe des Konzeptes möglich, welches ein Verbot von Gewaltdarstellungen gemäß § 131 StGB vorsieht. Ein solches Verbot gilt für Medien, die Gewalt verherrlichen, verharmlosen oder die Menschenwürde verletzen – dies auch im Hinblick auf „menschenähnliche Wesen“. Für diese Medien gilt ein generelles Verbreitungs- und Herstellungsverbot, so dass Computerspiele, wenn sie die genannten Voraussetzungen erfüllen, bereits heute unter § 131 StGB fallen und verboten werden können, egal ob es sich dabei um Offline- oder Online-Spiele handelt. Dies ist geltende Rechtslage in Deutschland – interessanterweise sind gegenwärtig lediglich zwei Spiele gemäß § 131 StGB verboten.
Nicht ganz zu Unrecht wurde die Vergabe der Alterskennzeichnung durch die USK in der Vergangenheit problematisiert. Ohne das Modell grundsätzlich in Frage zu stellen, legt uns die vorgebrachte Kritik an dem System der regulierten Selbstkontrolle aber nahe zu prüfen, ob das System hinreichend funktioniert. In der Diskussion ist beispielsweise auch, ob der Wortlaut des § 131 StGB tatsächlich geeignet ist, das gesetzgeberische Ziel zu erreichen, oder aber ob es hier einen Klarstellungsbedarf gibt.
Die Dreistufigkeit des Prüfverfahrens hat sich dennoch bewährt. Aber auch das beste System muss laufend auf seine Wirksamkeit kontrolliert werden, um auf Fehlentwicklungen reagieren zu können. Aus diesen Gründen ist das Hans-Bredow-Institut in Hamburg beauftragt worden, dass geltende Recht des Jugendmedienschutzes umfassend zu evaluieren. Die Ergebnisse dieser Evaluation sollen im Juni 2007 vorliegen, um dann so eventuelle Änderungen oder Klarstellungen am geltenden Recht vorzunehmen. Die Ergebnisse der Evaluation müssen allerdings, und dies fordere ich ausdrücklich, in jedem Fall Voraussetzung für die Anpassung rechtlicher Regelungen sein.
Die dargestellten gesetzlichen Regelungen bestärken mich in meiner Auffassung, dass es in Deutschland weniger ein Normendefizit, als vielmehr ein Vollzugsdefizit gibt - dies zeigen uns leider Testkäufe, die belegen, dass der Verkauf von nicht für die Altersstufe freigegebenen Medien an Jugendliche möglich ist. Hier müssen Kontrollen effektiver werden.
Dies zeigt aber auch, dass zur Umsetzung eines wirksamen Kinder- und Jugendmedienschutzes die Förderung und Stärkung von Medienkompetenz schon in Kindergarten, Schule und im Bereich der Jugendarbeit stehen muss. Medienerziehung und Medienverantwortung sind für einen modernen Kinder- und Jugendschutz von großer Bedeutung. Dies alles setzt eine ehrliche Diskussion über die Situation in den Schulen aber auch in den Familien voraus - Deutschland hat beispielsweise eine äußerst geringe Ausstattung mit SchulpsychologInnen. Angesichts der aktuellen Fälle muss
man sich auch immer wieder fragen, wie Eltern, Geschwister, Nachbarschaft, MitschülerInnen, LehrerInnen reagieren bzw. nicht reagieren, wenn Kinder und Jugendliche oft tagelang in die Parallelwelt der Computerspiele abtauchen sollten.
Die Argumentation bezüglich der Einführung eines Verbotes von so genannten „Killerspielen“ greift meiner Meinung nach viel zu kurz, blendet die geltende Rechtslage weitgehend aus und übersieht zudem die nicht weniger bedeutsamen Aspekte eines wirksamen Jugendmedienschutzes, nämlich die Frage des verantwortungsvollen Umgangs mit den Medien und die hierfür notwendige Medienkompetenz. Eine Debatte, die nur das Gefahrenpotenzial von Computerspielen im Auge hat, entspricht nicht der Vielfalt in diesem Bereich. Computerspiele in ihrer ganzen Breite sind inzwischen nicht nur beliebte Beschäftigung in allen Altersgruppen und Bevölkerungsschichten, sondern sind als interaktive Medien unbestritten auch ein Kulturgut. Das enthebt uns nicht der Verantwortung, den möglichen negativen Folgen von Bildschirmmedien, insbesondere auf den Schulerfolg, zu begegnen. Dennoch, insgesamt ist der Anteil an Computerspielen, welche als für Kinder und Jugendliche gefährlich eingestuft werden müssen, geringer, als es in der öffentlichen Diskussion den Anschein hat. Es ist daher ebenso notwendig, einen differenzierten Blick einzufordern, um nicht Spielerinnen und Spieler pauschal als “Killerspieler“ zu stigmatisieren.